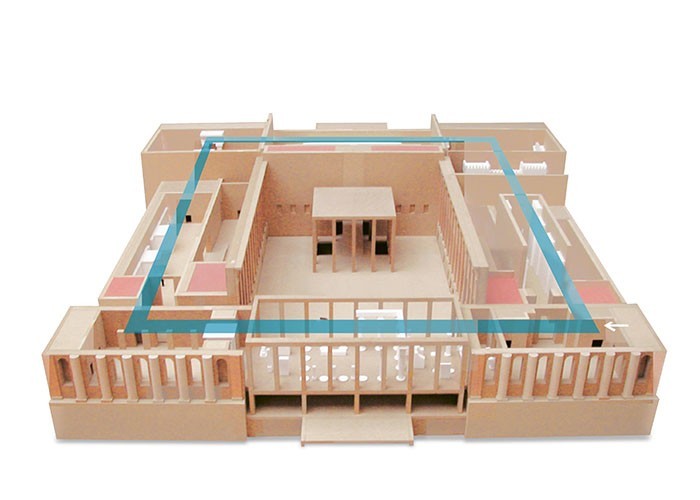Die Steinbilder des Tell Halaf-Museums – Rettung einer Sammlung
Von den folgenschwersten Luftangriffen auf Berlin im November 1943 waren auch die Ausstellungshalle des Tell Halaf-Museums und das Direktorialgebäude betroffen. In dem durch eine Phosphorbombe ausgelösten Feuer gingen alle Exponate aus Kalkstein, viele Kleinfunde sowie die monumentalen Gipsrekonstruktionen und Teile der islamischen Sammlung verloren, während die Basaltskulpturen schwer geschädigt wurden.
Bild: Überreste der Bildwerke nach der Brandkatastrophe im Keller des Pergamonmuseums, nach 1944